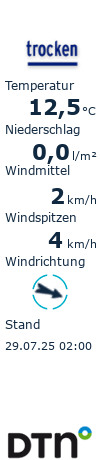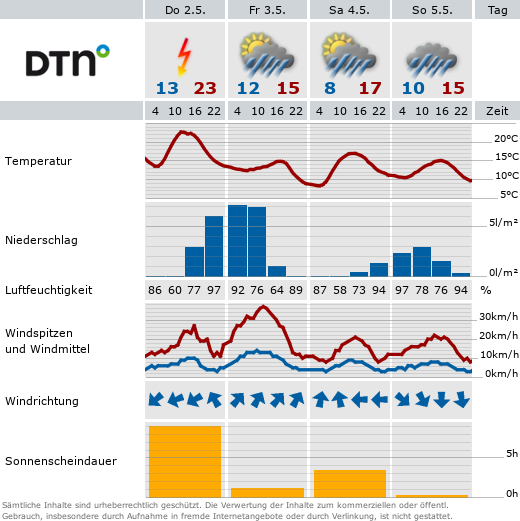AKTIF – Akademiker/innen mit Behinderungen in die Teilhabe- und Inklusionsforschung
Projektleitung: | Vertr. Prof. Dr. Monika Schröttle | |
MitarbeiterInnen: | Gudrun Kellermann, Dr. Rosa Schneider, Kathrin Vogt, Dr. Petra Anders, Dr. Christiane Barbara Pierl | |
Finanzierung: | Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerb. Menschen am Arbeitsleben, BMAS |
Projektbeschreibung:
Menschen mit Behinderungen haben noch immer nicht dieselben beruflichen Chancen in der Wissenschaft wie Nichtbehinderte. Im AKTIF-Projekt werden Wege entwickelt, diese Nachteile abzubauen und die Position von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Behinderungen in der Teilhabe/Inklusionsforschung sowie ihre Vernetzung mit den Disability Studies zu stärken. An 4 Standorten arbeiten bundesweit insgesamt 20 Wissenschaftler_innen in kleinen Teams zusammen(mindestens 50% mit Behinderung) und bauen gemeinsam inklusive Forschungsprojekte auf. Zum Internetauftritt des AKTIF-Projektes
Wie gelingt Integration? Eine empirische Untersuchung individueller Integrationserfahrungen behinderter Frauen und Männer in deren Lebensverläufen
Projektleitung: | Prof. Dr. Ulrike Schildmann | |
MitarbeiterInnen: | Dipl. Heilpäd. (FH) Sabrina Schramme, M.A. Rehabilitationswisenschaften | |
Finanzierung: | Im Rahmen der wiss. Mitarbeit am Lehrgebiet Frauenforschung |
Projektbeschreibung:
Schon seit den 1970er Jahren gibt es in Deutschland eine Integrationsbewegung, initiiert durch Eltern behinderter Kinder, welche das gemeinsame Leben und Lernen von Anfang an als Grundprinzip egalitärer Differenz für alle Kinder einforderte. Die „ehemaligen Integrationskinder“ blicken inzwischen auf einen Lebens-verlauf mit verschiedenen integrativen Momenten zurück. Durch die Erhebung biografischer Erfahrungen von Menschen mit Behinderung bezüglich ihrer Integrationserfahrungen soll dem, auch im Rahmen der Inklusionsdebatte und Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention, geforderten Motto von Menschen mit Behinderungen „nicht über uns ohne uns“ nachgekommen werden, ihre Erlebnisse bezüglich Teilhabe und gesellschaftlicher Integration über einen Teil der Lebensspanne wissenschaftlich zugänglich und für die Inklusionsdebatte- bzw. Inklusionspraxis und -theorie verwendbar gemacht werden.
Auf dem Weg zur inklusiven Schule – soziale Ungleichheitslagen in der Schulentwicklung
Projektleitung: | Prof. Dr. Ulrike Schildmann | |
MitarbeiterInnen: | Dipl. Heilpäd. (FH) Astrid Tan M.A. Rehabilitationswissenschaften | |
Finanzierung: | Wissenschaftliche Qualifikationsarbeit – Dissertation |
Projektbeschreibung:
In der qualitativen Studie werden Gelingensbedingungen für inklusive Schulentwicklung identifiziert werden, die unter den aktuellen Bedingungen unseres Schulsystems Schulen auf Ihrem Weg zur inklusiven Schule unterstützen können.
Umgang mit Heterogenität: Verhältnisse zwischen Behinderung und Geschlecht in der gesamten Lebensspanne
Projektleitung: | Prof. Dr. Ulrike Schildmann | |
MitarbeiterInnen: | Dipl. Reha. Päd. Tina Mattenklodt M. Ed. Wilhelm de Terra | |
Laufzeit: | Oktober 2010 bis September 2013 | |
Finanzierung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Projektbeschreibung:
Gleichberechtigte soziale Teilhabe behinderter Menschen einschließlich einer integrativen/inklusiven Bildung aller Mädchen und Jungen (vgl. UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen, 2006; von Deutschland 2009 ratifiziert) erfordert auf der einen Seite positive, demokratisch orientierte, pädagogische Arbeitsansätze, auf der anderen Seite aber ebenso eine fundierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit sozialen Ungleichheitslagen, die zu negativen Zuschreibungen und Statuszuweisungen führen und Behinderung (im sozialen Sinne) hervorbringen. Dieser anderen Seite widmet sich das vorliegende Forschungsprojekt: Es geht um die Untersuchung grundlegender – gesellschaftlich struktureller – Wechselwirkungen zwischen den Strukturkategorien Behinderung, Geschlecht und Alter/Lebensphasen (unter Berücksichtigung von Klasse/Schicht sowie kultureller Herkunft). Ziel ist es zu ermitteln, wie und unter welchen Bedingungen sich die verschiedenen Ungleichheitslagen gegenseitig beeinflussen, verstärken oder ggf. auch abschwächen.
Kinder mit Behinderungen im System der frühkindlichen Bildung - Eine Sekundäranalyse auf der Grundlage amtlicher Statistiken und ausgewählter Surveydaten
Projektleitung: | Prof. Dr. Ulrike Schildmann | |
Mitarbeiterin: | Dipl. Reha. Päd. Josefin Lotte | |
Laufzeit: | Oktober 2010 bis September 2013 | |
Finanzierung: | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Projektbeschreibung:
Das Promotionsvorhaben zielt auf die Entwicklung von Indikatoren zur Beschreibung und Bewertung der Situation von Mädchen und Jungen mit Behinderungen in dem System der frühkindlichen Bildung und der Auswirkungen ihrer individuellen Beeinträchtigung auf die Form ihrer Bildungsbeteiligung ab. Ausgehend von einer kritischen Betrachtung des Begriffs "Behinderung" als ein mehrdimesionales Phänomen werden die vorhandenen Daten zunächst dazu genutzt, die in der frühen Kindheit auftretenden Behinderungsarten unter Berücksichtigung der Geschlechter quantitativ zu untersuchen. Dieser Schritt der Analyse erfolgt explorativ unter Einbezug sämtlicher zur Verfügung stehender Daten aus amtlichenStatistiken und ausgewählten Surveys. In einem zweiten Analyseschritt wird die Bildungsbeteiligung der Kinder mit Behinderungen und somit ihre Teilhabe an Einrichtungen der Kindertagesbetreuung oder der Kindertagespflege untersucht. Dabei werden - soweit möglich - unterscheidliche Dimensionen betrachtet. Anhand multivariater Analysen werden die Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Behinderungen, dem Geschlecht und den Formen der Bildungsbeteiligung in der frühkindlichen Bildung sowie mögliche Risiko- und Schutzfaktoren analysiert. Die Entwicklung entsprechender Indikatoren stellt den letzten Schritt des Promotionsvorhabens dar.
Geschlechterverhältnisse in (sonder-)pädagogischen Berufen und universitären Ausbildungsgängen - eine empirische Untersuchung mit dem Ziel der Erhöhung des Anteils männlicher Pädagogen
Projektleitung: | Prof. Dr. Ulrike Schildmann | |
MitarbeiterInnen: | Dr. phil. Inken Tremel, Dipl.-Päd. Sebastian Möller, Sonderschullehrer | |
Laufzeit: | Dezember 2004 bis Juni 2006 | |
Finanzierung: | Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP) des Landes NRW |
Projektbeschreibung:
Bis zum Alter von zehn Jahren und damit bis zum Ende der Grundschulzeit werden Mädchen und Jungen in ihrer familialen und institutionellen Erziehung überwiegend mit weiblichen Kontaktpersonen konfrontiert: mit Müttern, Erzieherinnen, Grundschul- und ggf. Sonderschullehrerinnen. Männer waren auf diesen Feldern entweder nie präsent oder haben diese in den letzten Jahrzehnten vermehrt verlassen. Dies ist als eine problematische Tatsache bzw. Entwicklung anzusehen, da doch unter den Schülern, die in ihrer schulischen Entwicklung Verhaltensprobleme zeigen, überwiegend Jungen zu finden sind, denen es nicht zuletzt an männlichen Vorbildern mangelt. An diesem Punkt setzt das Forschungsprojekt an, das sich exemplarisch auf die sonderpädagogischen Studiengänge konzentriert: Untersucht wird nicht, warum (mit derzeit zwischen 10 und 20 %) immer weniger Männer in diesem Studienfächern zu finden sind, sondern umgekehrt: Unter welchen Bedingungen, mit welchen Motivationen und Perspektiven absolvieren diese (relativ wenigen) Männer ihr pädagogisches Studium? Im Zentrum steht eine empirische Untersuchung (Leitfaden-Interviews mit knapp 40 männlichen Studierenden der Rehabilitationswissenschaften/Lehramt und Diplom der Univversität Dortmund) und deren Auswertung. Die Forschungsergebnisse sollen sowohl für bildungstheoretische als auch bildungspolitische Entwicklungen genutzt werden.
Behinderung und Geschlecht: Prozesse der Herstellung von Identität unter widersprüchlichen Lebensbedingungen
Projektleitung: | Prof. Dr. Ulrike Schildmann | |
MitarbeiterInnen: | Dipl.-Päd. Bettina Bretländer | |
Laufzeit: | Mai 2001 bis April 2003 | |
Finanzierung: | Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP) des Landes NRW |
Projektbeschreibung:
Zentraler Untersuchungsgegenstand des Forschungsprojektes war die Erfassung des Lebensalltags und damit zusammenhängender Anforderungen an die Identitätsarbeit körperbehinderter Mädchen/junger Frauen (15 - 18 Jahre). Im Rahmen einer schriftlichen Befragung wurden insgesamt 106 Probandinnen mittels teilstandardisierter Fragebögen befragt; die quantitative Auswertung erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms SPPS für Windows; ein Ergebnisbericht liegt dem Wissenschaftsministerium des Landes NRW vor. Des Weiteren wurden 26 Probandinnen der o.g. Stichprobe anhand leitfadengestützter Interviews zusätzlich mündlich befragt. Die qualitative Auswertung (themenzentriert, inhaltsanalytisch) der Interviews erfolgte im Rahmen des Dissertationprojektes von Dipl.-Päd. Bettina Bretländer.
Leben an der Normalitätsgrenze. Behinderung und Prozesse flexibler Normalisierung Behindertenpädagogisches Teilprojekt der DFG-Forschungsgruppe "Normalismus" der Universität Dortmund
Projektleitung: | Prof. Dr. Ulrike Schildmann | |
MitarbeiterInnen: | Dipl.-Päd. Sabine Lingenauber Dr. Ute Weinmann | |
Laufzeit: | 1998 bis 2003 | |
Finanzierung: | Juli 1998 bis Juni 2001: Deutsche Forschungsgemeinschaft; Fortsetzung mit Mitteln der Universität Dortmund |
Projektbeschreibung:
Untersucht wurden die Verhältnisse zwischen Normalität, Behinderung und Geschlecht auf der theoretischen Grundlage der Normalismustheorie von Jürgen Link (Versuch über den Normalismus, 1997). Vor dem Hintergrund der behindertenpädagogischen Debatte wurden drei Untersuchungsschwerpunkte gewählt: ein historischer, ein integrationspädagogischer und ein feministischer. Ute Weinmann analysierte die Konstruktion von Normalität und Abweichung in den ersten theoretischen Schriften der Heilpädagogik (um 1860) und in ausgewählten Schriften der 20 er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Sabine Lingenauber untersuchte das Verhältnis der Integrationspädagogik (Gesamtwerke von Hans Eberwein und Georg Feuser 1970-2000) zur gesellschaftlichen Normalität. Ist es normal verschieden zu sein, wie die Integrationspädagogik propagiert? Ulrike Schildmann untersuchte die Gesamtwerke (1970-2000) zweier Autorinnen, Barbara Rohr und Annedore Prengel, die sich systematisch und durchgängig mit "Behinderung und Geschlecht" befassen, darauf hin, wie sie mit der Konstruktion gesellschaftlicher Normalität umgehen, diese interpretieren und selbst beeinflussen. Die Ergebnisse wurden publiziert in der Reihe "Konstruktionen von Normalität", 5 Bände, hrsg. von Ulrike Schildmann, Opladen (Leske + Budrich) 2001-2004.